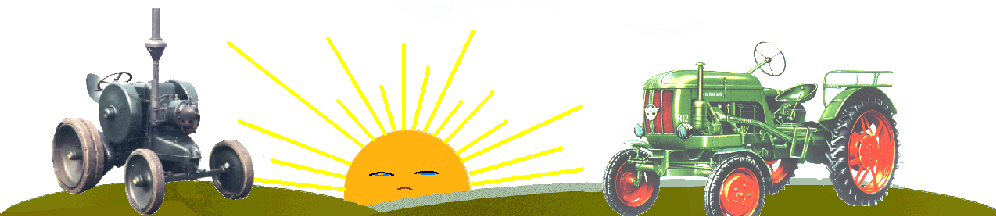Lanz-Bulldog ----- ein eigenwilliges Konzept
 Ohne den
Bulldog sind heute Alt-Traktoren-Treffen so wenig
vorstellbar......, als würde es Mittag ohne Kartoffeln geben.
Wer so einen Oldie haben möchte, muß auch tiefer in
die Tasche greifen. Und das ist schon recht merkwürdig,
scheiden sich doch beim Lanz Bulldog dieGeister. Es ist lange her, da
wurde er als erster Schweröl-Schlepper der Welt auch zu
Deutschlands bekanntestem Trecker.
Ohne den
Bulldog sind heute Alt-Traktoren-Treffen so wenig
vorstellbar......, als würde es Mittag ohne Kartoffeln geben.
Wer so einen Oldie haben möchte, muß auch tiefer in
die Tasche greifen. Und das ist schon recht merkwürdig,
scheiden sich doch beim Lanz Bulldog dieGeister. Es ist lange her, da
wurde er als erster Schweröl-Schlepper der Welt auch zu
Deutschlands bekanntestem Trecker.
Mit seiner eigenwilligen Technik
nahm er aber zwischen den allmählich aufkommenden und stetig
verbesserten Dieselschleppern eine Sonderrolle ein und erfuhr bis zu
seinem Ende sowohl hingebungsvolle Freundschaft als auch heftige
Ablehnung. Seine Freunde schwärmten von ihm wie von einem
guten Kameraden. Die anderen hielten ihn für
vorsintflutlich.
Ein Bauer erzählte mir mal, er hätte einen
ausgedienten D 4016 durch einen modernen 75iger IHC ersetzt und wie den
Bulldog vorher auch in der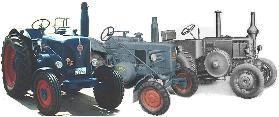 Kartoffelernte vor den Sammelwagen gespannt und mit dem vollen Fuder
festgefahren. „Verdammi noch mol, dat heb wie doch
mit den Bulldog nie nich beleeft. Dat will ick nu ober ganz ganau
weeten.“
Kartoffelernte vor den Sammelwagen gespannt und mit dem vollen Fuder
festgefahren. „Verdammi noch mol, dat heb wie doch
mit den Bulldog nie nich beleeft. Dat will ick nu ober ganz ganau
weeten.“
Er spannte den Cormick ab und holte den Bulldog aus dem Schuppen, um ihn in der ausgekratzten Spur vor den vollen Wagen zu spannen. Und der PS mäßig nur halb so starke Bulldog zog den Wagen mühelos aus der eingebuddelten Spur heraus. So war der Bulldog. Und man sagte damals eben nicht zu Unrecht: „Der Lanz der kanns“.
Irgendwann ab den 60iger
Jahren war dann aber endgültig Schluß mit
Bulldog und Co, bis die Besucher von Oldtimer-Veranstaltungen ihn
wieder entdeckten und zu ihrem Liebling erkoren. Darum ist er wieder so
begehrt. Und es bleiben die schönsten Diesel
unbeachtet, wenn ein alter  Bulldog
gestartet wird. Die Anziehungskraft des Lanz Bulldog ist schwer
beschreibbar, hat aber zweifellos mit der eigenwilligen Technik zu tun.
Früher warb Lanz mit seiner Robustheit, worunter
häufig besseres Material verstanden wurde, nicht aber der zu
weniger Schleiß führende niedrige Verdichtungsdruck
der Maschine und die einfache Einspritzung. Diese Eigenheiten
des
Bulldog machten ihn gerade in der Anfangszeit der Motorisierung auf dem
Land
Bulldog
gestartet wird. Die Anziehungskraft des Lanz Bulldog ist schwer
beschreibbar, hat aber zweifellos mit der eigenwilligen Technik zu tun.
Früher warb Lanz mit seiner Robustheit, worunter
häufig besseres Material verstanden wurde, nicht aber der zu
weniger Schleiß führende niedrige Verdichtungsdruck
der Maschine und die einfache Einspritzung. Diese Eigenheiten
des
Bulldog machten ihn gerade in der Anfangszeit der Motorisierung auf dem
Land so
unschlagbar, erforderten aber auch Einfühlung in die Technik
und etwas technisches Geschick.
so
unschlagbar, erforderten aber auch Einfühlung in die Technik
und etwas technisches Geschick.
Bei unsachgemäßem Umgang verloren sich die Vorteile dieses Konzepts schnell. Denn nicht jeder bekam ihn in Gang und konnte ihn gut fahren. So war eben ein erfolgreicher Bulldog-Fahrer auch ein ganzer Kerl und ist es, seien wir mal ehrlich, bis heute geblieben. Hingebungsvollen Pflegeaufwand dankte die Maschine mit Einsatzbereitschaft und ungewöhnlicher Leistung. So wuchsen Fahrer und Gefährt zusammen. Nachlässigkeit führte zu Ärger. Vielleicht läßt sich das gespaltene Image des Lanz-Bulldog neben der aufholenden einfacher zu bedienenden Diesel-Technik auf diese Weise erklären.
Angefangen aber hat alles mal kurz vor Beginn der
zwanziger
Jahre. Der
erste Weltkrieg war überstanden, Motorisierung kein Fremdwort
mehr. In der Landwirtschaft trieben weiterhin Dampfmaschinen die
Dreschsätze und Steinbrecher für den
Wegebau oder zogen auf großen
Gütern auch schon mal schwere Seilzug-Pflüge
über den Acker. Daß die Motorisierung vor der
Landwirtschaft Halt machte, lag nicht an der Güte der
damaligen Motoren sondern am hohen Benzin-Verbrauch und =Preis; denn  Dieselmotoren
gab es noch nicht. Pferdegespanne stellten also weiter die Zugkraft auf
den Feldern.
Dieselmotoren
gab es noch nicht. Pferdegespanne stellten also weiter die Zugkraft auf
den Feldern.
Auf der Straße sah es ganz anders aus; denn
Kraftverkehr war lohnender. Immer mehr Autos verbrauchten immer mehr
Benzin und ähnlich leichte Kraftstoffe. Bei deren Herstellung
fiel als Abfall ein Schweröl an , das trotz seines wesentlich  höheren
Energiegehalts als Treibstoff für Verbrennungsmotoren nicht zu
gebrauchen war. Das Problem lag in seinem hohen Flammpunkt,
während Benzin schon bei niedrigen Temperaturen verdunstet und
sein Gemisch mit Luft im Motor durch einen winzig kleinen
Zündfunken explodiert.
höheren
Energiegehalts als Treibstoff für Verbrennungsmotoren nicht zu
gebrauchen war. Das Problem lag in seinem hohen Flammpunkt,
während Benzin schon bei niedrigen Temperaturen verdunstet und
sein Gemisch mit Luft im Motor durch einen winzig kleinen
Zündfunken explodiert.
Dieses billige Schweröl zum Antrieb für Motoren nutzbar zu machen, wurde also zu einer lohnenden Aufgabe für Ingenieure und Wissenschaftler. Rudolf Diesel erhielt ein Patent auf einen Schweröl-Motor, der angesaugte reine Luft so stark verdichtet und damit erhitzt, daß nach dem Einspritzen von möglichst fein vernebeltem Schweröl kurz vor OT die Verbrennung des heißen Schweröl/Luft-Gemisches erfolgt.
Die Idee war
gut, nur konnte man damals so hohe Verdichtungen in Motoren
und die dazu nötigen Einspritz-Drücke aus
Material-Gründen weder erreichen noch die
zwangsläufig auftretenden Lagerdrücke
schmiermäßig beherrschen. Dazu kam die hohe
Verbrennungs-Temperatur von ca
1000°C gegenüber Benzin mit ca 600°C.
Erst Ende der 30iger Jahre setzte sich der Dieselmotor im
Fahrzeugbau durch. Seit dieser Zeit heißt das
Schweröl zum Antreiben von Verbrennungsmotoren
Dieselöl. Und bei modernsten Fahrzeugen und Motoren steht noch
heute der Buchstabe D für die v on Rudolf
Diesel erdachte Technik.
on Rudolf
Diesel erdachte Technik.
Nun aber zurück in die Zeit vor 1920! Weil Schweröl zum Antrieb von Fahrzeug-Motoren wirtschaftlich hoch interessant war, wurde getüftelt. Wir vergessen heute oft, daß Treib= und Schmierstoffe bis heute ebenfalls eine enorme Entwicklung durchlaufen haben. Damals waren die Qualitäten noch ungleichmäßig und schlecht, die Scherfestigkeit von Schmieröl mangelhaft, die Viskosität von der Temperatur abhängig. Tankstellen waren selten und mit den heutigen nicht zu vergleichen. Treibstoffe wurden noch lange Zeit per Bahn mit 200 ltr Fässern transportiert und mußten von dort abgeholt werden. Vor diesem Hintergrund muß man die damalige Technik betrachten und bewundern.
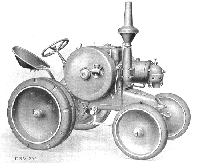 Mit dem ersten
Rohöl-Schlepper der Welt kam
schließlich 1921 die Heinrich Lanz AG aus Mannheim auf
den Markt, zwar nur 12 PS stark, aber einfach in der
Konstruktion, günstig im Preis, genügsam im Verbrauch
von Treibstoff und Schmieröl und tüchtig mit seiner
großen Riemenscheibe beim Betreiben der damals vielen
gebräuchlichen Standmaschinen zum Dreschen, Pumpen,
Steinbrechern, Buschhacken oder zur Stromerzeugung. Er konnte auch
ziehen---trecken---schleppen, woraus später die Begriffe
Trecker, Schlepper oder Traktor von Traktion entstanden.
Mit dem ersten
Rohöl-Schlepper der Welt kam
schließlich 1921 die Heinrich Lanz AG aus Mannheim auf
den Markt, zwar nur 12 PS stark, aber einfach in der
Konstruktion, günstig im Preis, genügsam im Verbrauch
von Treibstoff und Schmieröl und tüchtig mit seiner
großen Riemenscheibe beim Betreiben der damals vielen
gebräuchlichen Standmaschinen zum Dreschen, Pumpen,
Steinbrechern, Buschhacken oder zur Stromerzeugung. Er konnte auch
ziehen---trecken---schleppen, woraus später die Begriffe
Trecker, Schlepper oder Traktor von Traktion entstanden. Dieser Trecker
war unempfindlich gegen die damaligen qualitativ
unregelmäßige Kraftstoffe. Seine Instandhaltung und
Wartung konnte in jeder Dorfschmiede mit ortsüblichen Mitteln
erfolgen. Das war zu jener Zeit ein Garant für
Zuverlässigkeit; denn Ersatzteilversorgung per Eilboten wie
heute gab es noch nicht. Die geniale Lösung
für das Schwerölproblem war sein 2
Takt-Glühkopfmotor, der das Rohöl bei nur geringem
Verdichtungsdruck mit Hilfe der Strahlungswärme des
ungekühlten Zylinderkopfes verarbeiten konnte. Der Treibstoff
wurde schon 120° vor OT (bei modernen Dieselmotoren ca
20° vor OT), bei noch nicht aufgebautem Verdichtungsdruck also,
in den glühenden Zündsack gespritzt und dort
verdampft.
Dementsprechend genügten Einspritzpumpe
und =Düse in einfachster Bauweise. Durch den geringen
Druckaufbau im Motor machte die 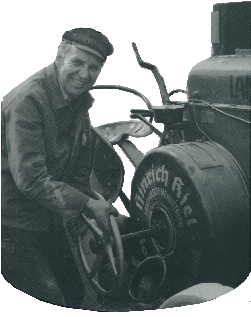 Schmierung mit den
noch wenig
entwickelten Schmierölen keine Probleme.
Schmierung mit den
noch wenig
entwickelten Schmierölen keine Probleme.
Dieser Trecker erhielt von Lanz den Namen Bulldog und wurde mit seinen Nachfolgern durch die gute Bewährung in der Praxis für lange Zeit zum Begriff für eine landwirtschaftliche Zugmaschine schlechthin. Zum Anlassen der Maschine mußte der Zündsack im Glühkopf mittels einer Heizlampe kräftig angeheizt werden. Während dieser Zeit ließen sich Schmier= und Wartungsarbeiten verrichten.. Dann wurden die Zündungen durch Anpendeln mittels Griff in die Speichen des Schwungrades oder des in die Kurbellwelle gesteckten Lenkrades eingeleitet.
Der zeitaufwendige Anlaßvorgang geriet aber durch das Aufholen der Konkurrenz mit ständig weiter entwickelten Dieselmotoren immer mehr zum Nachteil für den Bulldog, je wechselvoller die Einsatzbereiche in der Praxis sich wandelten. Heute aber sind gerade diese Start Vorbereitungen der größte Publikumsmagnet bei Alt-Traktoren-Treffen. Könner auf diesem Gebiet ziehen dabei eine solche Show ab, daß der schönste Diesel unbeachtet bleibt...
Während die Heizlampe mit schön
blauer Flamme unter dem Glühkopf des Bulldog hängt,
wird das Publikum unterhalten und abgelenkt. Beginnt sich der
Zündsack etwas orange zu verfärben, holt man das
Lenkra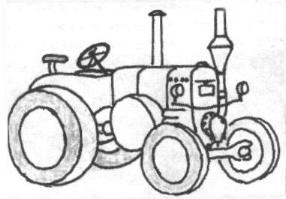 d aus dem
Führerstand,
um es seitlich in die
Kurbelwellennut zu schieben. Unbemerkt wird gegen die Laufrichtung auf
Kompression gedrückt, festgehalten und mit 3
Pumpenstößen eine anfänglich nur zu ahnende
Verbrennung eingeleitet, welche den Motor ohne Pendeln und Anstrengung
in Gang bringt und sofort mit bereits vorhandener Betriebstemperatur
weiter laufen läßt. Inzwischen sitzt das Lenkrad
wieder in seiner Halterung im Führerstand, und der Beifall
brandet auf. Solche Vorstellungen sind herrlich. Sie sind auch der
Beweis für den guten Zustand der Maschine und die
Geschicklichkeit des Fahrers.
d aus dem
Führerstand,
um es seitlich in die
Kurbelwellennut zu schieben. Unbemerkt wird gegen die Laufrichtung auf
Kompression gedrückt, festgehalten und mit 3
Pumpenstößen eine anfänglich nur zu ahnende
Verbrennung eingeleitet, welche den Motor ohne Pendeln und Anstrengung
in Gang bringt und sofort mit bereits vorhandener Betriebstemperatur
weiter laufen läßt. Inzwischen sitzt das Lenkrad
wieder in seiner Halterung im Führerstand, und der Beifall
brandet auf. Solche Vorstellungen sind herrlich. Sie sind auch der
Beweis für den guten Zustand der Maschine und die
Geschicklichkeit des Fahrers.
Wird nun auf einer
Veranstaltung nach einem Glühkopf gefragt, so ist
der bis jetzt beschriebene 1921 zum ersten Mal aufgetauchte und bis zu
seinem Verschwinden ca 1958 ständig weiter entwickelte, im
Motorprinzip aber unveränderte Bulldog-Typ mit der
„Beule“ vorne über der Vorderachse,
dem so genannten Glühkopf gemeint.
Es gibt einen
Glühkopf-Bulldog ohne diese vordere Beule. Das ist
der 16er
„Schmalhans-Bulldog von 1950 mit einem
Seitenglühkopf.
Lanz hielt stur am einzylindrigen 2-Takt
Glühkopfmotor fest, obwohl die Diesel= und die Treibstoff=  und
Schmieröl-Technik inzwischen weit fortgeschritten waren. Die
Kundschaft aber blieb dem Bulldog treu. Als Lanz den Wettlauf mit
seinen Konkurrenten zu verlieren drohte, kamen im Herbst 1952 nach
dreijähriger Entwicklung neue Bulldogs mit
neuartigen Motoren aus Mannheim auf den Markt. Diese Motoren
ähnelten im Aufbau den alten sehr,
und
Schmieröl-Technik inzwischen weit fortgeschritten waren. Die
Kundschaft aber blieb dem Bulldog treu. Als Lanz den Wettlauf mit
seinen Konkurrenten zu verlieren drohte, kamen im Herbst 1952 nach
dreijähriger Entwicklung neue Bulldogs mit
neuartigen Motoren aus Mannheim auf den Markt. Diese Motoren
ähnelten im Aufbau den alten sehr, 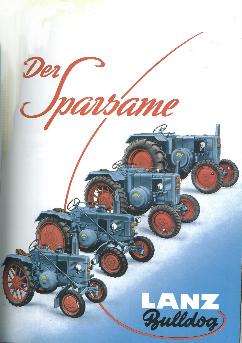 zeichneten sich aber durch
ein vollkommen neues Brennverfahren aus. Der
Zylinderkopf beherbergte keinen Glühkopf mehr, blieb aber bis
auf den Düsensitz in seiner kegeligen Mitte
ungekühlt. Dadurch blieb das Prinzip der Verdampfung des
eingespritzten Dieseltreibstoffs erhalten, was zu einer sehr guten
Verbrennung beiträgt.
zeichneten sich aber durch
ein vollkommen neues Brennverfahren aus. Der
Zylinderkopf beherbergte keinen Glühkopf mehr, blieb aber bis
auf den Düsensitz in seiner kegeligen Mitte
ungekühlt. Dadurch blieb das Prinzip der Verdampfung des
eingespritzten Dieseltreibstoffs erhalten, was zu einer sehr guten
Verbrennung beiträgt.
Wenn Bulldogs qualmen, so ist das kein Tränen in die Augen treibendes Rußen wie bei Viertaktern sondern Ölqualm als sicheres Zeichen seiner 2-Taktigkeit. Der Übergang vom Zylinderkopf zum Zylinder war jetzt kein Flaschenhals mehr sondern großflächig, so daß mit Hilfe einer Hochdruck -Einspritzanlage von Bosch die Zündung exakt bestimmt und auf 20° vor OT vorverlegt werden konnte. Wegen der günstigen Wärmeverhältnisse im neuen Motor konnte der Kolben aus Aluminium gefertigt und die Schwungmasse reduziert werden mit der Möglichkeit höherer Drehzahlen.
Die Verbrauchswerte
lagen unter allen bisher im Kleindieselbereich für
möglich gehaltenen 175 g/PSh. Angelassen wurde der Bulldog
mittels Pendel-Anlasser und Zündkerze mit einem
Benzin/Diesel-Gemisch und zeigte dabei hervorragende
Starteigenschaften. Für die damalige Zeit schon wieder
nachteilig war nur, daß vor dem Abstellen vor
längeren Ruhepausen 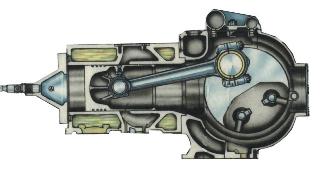 rechtzeitig
auf das Startgemisch umgestellt werden mußte, damit es beim
Neustart zur Verfügung stand. Der Start erfolgte aber
schneller als bei Dieseln, weil das Vorglühen, die s.g. Rudolf
Diesel Gedenkminute, entfiel.
rechtzeitig
auf das Startgemisch umgestellt werden mußte, damit es beim
Neustart zur Verfügung stand. Der Start erfolgte aber
schneller als bei Dieseln, weil das Vorglühen, die s.g. Rudolf
Diesel Gedenkminute, entfiel.
Die gegenüber dem Glühkopfmotor etwas erhöhte Verdichtung brachte diesen Motor in die Nähe von Diesel-Eigenschaften und zusammen mit dem Benzin-Start die Bezeichnung „Halbdiesel“ ein. Immerhin betrug aber die Verdichtung nur das halbe Maß von echten Dieseln und verhalf den Schleppern aus der Halb-Diesl-Baureihe, die hinter der PS-Angabe den Zusatz 06 tragen, zu beachtlicher Robustheit und Lebensdauer und Lanz wieder zum dringend nötigen Anschluß an das Weltniveau. Erkennen kann man diese Bulldogs an der fehlenden „Beule“ über der Vorderachse und einer noch fehlenden großflächigen Motorhaube wie bei den späteren „Volldieseln“.
Schon 1955 war die
Zeit der kleinen „Halb-Diesel“ vorbei. In diesem
Jahr wurde eine neue Bulldog-Reihe mit ähnlichen aber
verfeinerten Eigenschaften wie den Vorgängern vorgestellt. Das
Aussehen hatte sich durch eine großflächige
Motorhaube stark verändert und zum Vorteil des Bulldog dem
allgemeinen Trend angepaßt. Auf die Riemenscheibe auf der
rechten Schwungradseite konnte inzwischen verzichtet und damit die
Schwungmasse weiter  verringert
werden. Das verbesserte auch die Schaltbarkeit des Getriebes. Der
Aufbau der Schlepper war vereinfacht worden und erlaubte eine
rationellere Fertigung.
verringert
werden. Das verbesserte auch die Schaltbarkeit des Getriebes. Der
Aufbau der Schlepper war vereinfacht worden und erlaubte eine
rationellere Fertigung.
Nach weiterer geringfügiger
Erhöhung der Verdichtung verzichtete man auf den Benzin-Start
und rüstete die Schlepper mit einer
Glüh-Anlaß-Vorrichtung aus. Der
Startvorgang 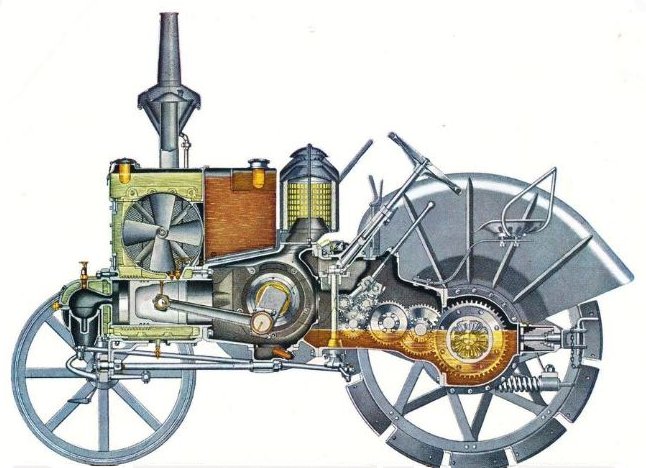 erfolgte jetzt
wie bei einem Dieselmotor und brachte ihnen darum zum Unterschied zu
den mit Benzin und Zündkerze startenden
„Halbdieseln“ die Bezeichnung
„Volldiesel“ ein, ohne sie auch nur in die
Nähe echter Diesel-Schlepper zu bringen. Die Verdichtung lag
immer noch weit darunter und sollte zu einem langen Schlepper-Leben
beitragen.
erfolgte jetzt
wie bei einem Dieselmotor und brachte ihnen darum zum Unterschied zu
den mit Benzin und Zündkerze startenden
„Halbdieseln“ die Bezeichnung
„Volldiesel“ ein, ohne sie auch nur in die
Nähe echter Diesel-Schlepper zu bringen. Die Verdichtung lag
immer noch weit darunter und sollte zu einem langen Schlepper-Leben
beitragen.
Allen Bulldogs ist gemeinsam, daß sie Zweitakter sind. Viertakt-Dieselmotoren fehlt der Vorteil eines ungekühlten Zylinderkopfs, wie er in abgewandelter Form praktisch auch in den „Halb= und Voll-Dieseln“ weiter verwendet wurde. Das ist mit Sicht auf eine saubere Verbrennung ein Nachteil.
Durch die bei allen Bulldogs praktizierte
Kurbelgehäuse-Aufladung aber mußte die Schmierung
der Motorteile von außen erfolgen und war somit
anfälliger als die Sumpfschmierung von innen bei der
Konkurrenz. Eine Kolben-Ölpumpe versorgt über
Rohrleitungen den Kolben und über diesen auch den
Kolbenbolzen, dazu über 2 weitere Leitungen die beiden
Kurbelwellenlager. Das Pleuellager wird über einen
Schleuderring und Bohrungen in der Kurbelwelle von Öl aus dem
linken Kurbelwellenlager geschmiert. Überschüssiges
Öl, das sich im Kurbelgehäuseboden sammelt, wird von
einer Zahnradpumpe abgesaugt und über einen Feinfilter in den
Öltank zurück befördert. Mit einer 3.und von
Hand bedienten Pumpe läßt sich Motoröl nach
längerer Standzeit des Schleppers vorpumpen. Bei neueren
Bulldogs war die Schmierölmenge belastungsabhängig. Die ganze Schmiereinrichtung
ist effektiv und sicher, solange keine
Eingriffe erfolgen und nach Anleitung verfahren wird.
Die ganze Schmiereinrichtung
ist effektiv und sicher, solange keine
Eingriffe erfolgen und nach Anleitung verfahren wird.
Es hat schon
Bulldogs mit Wasserschmierung gegeben, weil das Kondenswasser im
Öltank bis über die Absaugleitung gestiegen war. Auch
hat der Bulldog das Nachsehen, wenn nach Reparaturen an der Kurbelwelle
oder dem Regler Ölleitungen unsachgemäß
behandelt werden. Sicher ist bei
manchem Bulldog der Vorteil seiner geringen Verdichtung und der damit
verbundenen Robustheit durch die kompliziertere und
anfälligere Schmierung wieder
verloren gegangen.
Das
Festhalten am ungekühlten
Zylinderkopf
war sicher
kein Fehler, an der Einzylindrigkeit sicher um so mehr.
Auch fehlte
wohl seit Kriegsende der Spielraum für noch tiefer
greifende
Entwicklungen.
ungekühlten
Zylinderkopf
war sicher
kein Fehler, an der Einzylindrigkeit sicher um so mehr.
Auch fehlte
wohl seit Kriegsende der Spielraum für noch tiefer
greifende
Entwicklungen.
Oskar