

Leistungspflügen

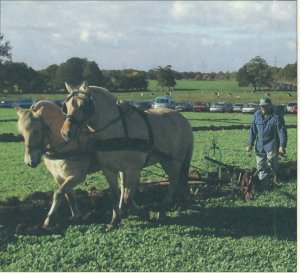 Hierbei
geht es um eine für den Trecker eher geruhsame, für
seinen
Fahrer um so anstrengendere Sportart, die früher keine war.
Das
ist kein Wettkampf um Flächenleistungen sondern um saubere
Pflugarbeit... nach alten und festen Regeln, auf einem zugewiesenen
eigenen Acker, im Vergleich zu Mitbewerbern auf
Nachbargrundstücken.
Hierbei
geht es um eine für den Trecker eher geruhsame, für
seinen
Fahrer um so anstrengendere Sportart, die früher keine war.
Das
ist kein Wettkampf um Flächenleistungen sondern um saubere
Pflugarbeit... nach alten und festen Regeln, auf einem zugewiesenen
eigenen Acker, im Vergleich zu Mitbewerbern auf
Nachbargrundstücken. Das Pflügen war für unsere Oldtimer normaler Alltag, als sie noch jung waren. Eine saubere Pflugfurche war damals wie heute für die Bodenfruchtbarkeit von allergrößter Bedeutung. Ihre Ausführung mit den damaligen Geräten aber war eine echte Kunst, vergleichbar mit der Geschicklichkeit eines begabten Handwerkers, und gehörte darum selbstverständlich zur Ausbildung im landwirtschaftlichen Beruf.

Bei der Gehilfenprüfung musste vorgepflügt werden nach einem aus der Praxis abgeleiteten standardisierten Regelwerk.
Die Landwirtschaftskammer als Dachorganisation überwachte d
 ie
Einhaltung und unterstützte später Wettkämpfe
von guten
Pflügern auf der Basis des Prüfungs-Reglements. Diese
Wettkämpfe nannte man damals Leistungspflügen.
ie
Einhaltung und unterstützte später Wettkämpfe
von guten
Pflügern auf der Basis des Prüfungs-Reglements. Diese
Wettkämpfe nannte man damals Leistungspflügen. Sie wurden auf dörflicher Ebene bis hin zur Weltmeisterschaft ausgetragen und wirkten enorm Praxis fördernd.
Wer kennt nicht die Realität vom Wandel derZeit und erinnert sich an das schöne Frühlingslied: „Im Märzen der Bauer die Rösslein anspa
 nnt...?“
Wo
wäre unser schönes Hobby, wären die
Rösser nicht
schließlich diesem Wandel zum Opfer gefallen und von Bulldogs
und
Dieseln ersetzt worden? Auch diese
pflügten immer noch
nach den altbewährten Regeln, wenn auch mit
größeren
Geräten.
nnt...?“
Wo
wäre unser schönes Hobby, wären die
Rösser nicht
schließlich diesem Wandel zum Opfer gefallen und von Bulldogs
und
Dieseln ersetzt worden? Auch diese
pflügten immer noch
nach den altbewährten Regeln, wenn auch mit
größeren
Geräten. 
Heute aber wird anders gepflügt. Wir haben Regelhydraulik, die das Pflügen zum Kinderspiel macht. Wir haben sehr leistungsfähige Schlepper mit vielscharigen Volldrehpflügen, so dass eine Hunderte von Jahren geübte Aufteilung des Ackers in Beete unnötig wurde. Das selbe Schicksal ereilte die Ausbildung am Pflug. So zog sich schließlich auch die Landwirtschaftskammer vom Leistungspflügen zurück, weil es zur Berufsförderung nicht mehr nötig war.

Trotzdem wurde es unter guten und besten Pflügern in dieser Disziplin als Wettkampf weiter betrieben und dürfte folglich ohne Beruf
 sbezogenheit als Sportart
bezeichnet werden können, die weltweit mit modernen
Schleppern und zum Teil hochgezüchtetem Gerät immer
noch
ausgeübt wird. Seit alte ausrangierte Trecker vor
der Verschrottung bewahrt und
liebevoll wiederhergestellt werden, seit sich ihre Besitzer in
Clubs
zusammenschließen, um
Erfahrungen auszutauschen, ziehen
Oldtimerfreunde auf vielen Pflügerveranstaltungen
wieder ihre
Furchen, nicht zum Broterwerb sondern aus Spaß an der Freud.
Dabei pflügen sie wie in alten Zeiten
und mit den
alten Geräten.
Sie
sbezogenheit als Sportart
bezeichnet werden können, die weltweit mit modernen
Schleppern und zum Teil hochgezüchtetem Gerät immer
noch
ausgeübt wird. Seit alte ausrangierte Trecker vor
der Verschrottung bewahrt und
liebevoll wiederhergestellt werden, seit sich ihre Besitzer in
Clubs
zusammenschließen, um
Erfahrungen auszutauschen, ziehen
Oldtimerfreunde auf vielen Pflügerveranstaltungen
wieder ihre
Furchen, nicht zum Broterwerb sondern aus Spaß an der Freud.
Dabei pflügen sie wie in alten Zeiten
und mit den
alten Geräten.
Sie  schauen, ob`s noch geht, erfreuen das Publikum, pflügen
aber
leider oft nur hintereinander in einer Furche...gute und
schlechte flüger, alles durcheinander. Wer mal
Leistungspflügen erlebt
hat, und sich was zutraut, träumt vom eigenen Acker
schauen, ob`s noch geht, erfreuen das Publikum, pflügen
aber
leider oft nur hintereinander in einer Furche...gute und
schlechte flüger, alles durcheinander. Wer mal
Leistungspflügen erlebt
hat, und sich was zutraut, träumt vom eigenen Acker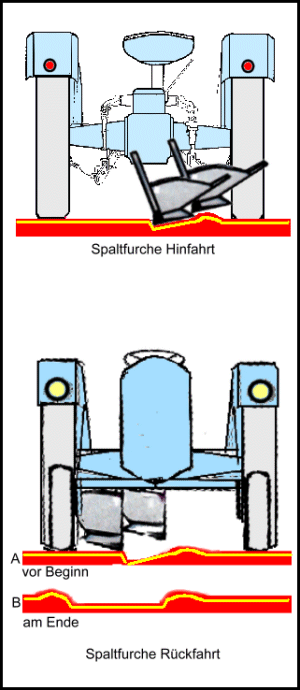 , den er selber
beginnen und zu Ende führen darf.
, den er selber
beginnen und zu Ende führen darf. So ungefähr könnte die Wiederbelebung alter Prüfungsszenarien mit altem Gerät in Gange gekommen sein; denn tatsächlich sieht man sie wieder, zwar noch selten, ihre Furchen nach alten Regeln im Wettstreit miteinander ziehen.
Tatkräftige
Unterstützung bekam diese Bewegung vom LBCH durch seinen
ehemaligen Vorsitzenden Werner Holtz, der in engen Kontakten
zum deutschen Pflügerrat dessen Know How zu nutzen
wusste.
Ich berichte hier nicht für Kenner der Materie
sondern
für die Greenhorns unter uns, die ohne den Vorzug einer
entsprechenden Ausbildung auch am Leistungspflügen teilnehmen
wolle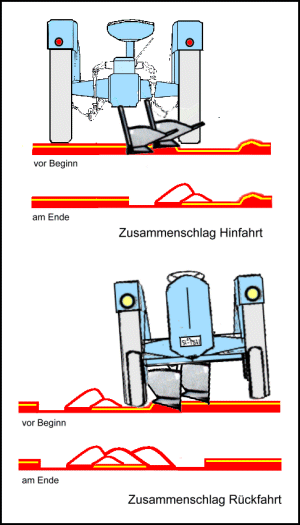 n,
und zwar mit Erfolg. Für sie war in der Schlepper Post
in ihrer März-Ausgabe 2004 der Aufsatz mit dem Titel:
„Im Märzen der Bauer...“ als
Vorbereitung für das
heutige Thema gedacht.
n,
und zwar mit Erfolg. Für sie war in der Schlepper Post
in ihrer März-Ausgabe 2004 der Aufsatz mit dem Titel:
„Im Märzen der Bauer...“ als
Vorbereitung für das
heutige Thema gedacht.
Wer heute ohne Vorkenntnisse der früheren landwirtschaftlichen Arbeitsmethoden den Regeln des Leistungspflügens gegenübersteht, wird sich beim Vergleich zum heutigen Pflügen sicher wundern. Denn in alten Zeiten wurde meistens mit einfachen Beetpflügen gearbeitet, welche die Furchen nur nach rechts wenden. Man pflügte also um eine Mittelfurche so lange herum, bis das gepflügte Beet eine angemessene Breite erreicht hatte, und begann dann ein neues.
Dieses und das vorige, die man Zusammenschlag nennt, wurden so angelegt, dass bei Fertigstellung ein Restbeet zwischen den Zusammenschlägen in der Breite eines von ihnen übrig blieb. Mit wachsender Beetbreite wächst auch der Weg des Gespanns auf dem Vorgewende. Bis ca. 40 mtr. ist dieser gerade noch erträglich und bestimmte damit ebenfalls die Beetbreite. Im folgenden Jahr wurde die Anpflugfur che
über der Schlussfurche des
Vorjahres ausgeführt.
che
über der Schlussfurche des
Vorjahres ausgeführt.
Da Anpflugfurchen leicht einen Buckel, die Schlussfurchen leicht einen flachen Graben hinterlassen, blieben sie bis zur Einführung der Volldreh-Pflüge Sichtmarken für die Beet-Einteilung des Ackers.
Die Regeln des Leistungspflügens resultieren aus der Beet-Pflügerei vergangener Zeiten. Dabei unterliegt schon der Zusammenschlag schwierigen Kriterien, die in der zurückliegenden Praxis ihre Berechtigung hatten. Die strenge Forderung nach Geradlinigkeit der ersten Furche z.B. war für den Wechsel von Anpflug= und Schlussfurche im Jahreswechsel
wichtig, die Forderung
nach einer sauberen Schlitzfurche vor dem Zusammenschlag
für
die Reinhaltung des Ackers vor
Unkraut.
Jahreswechsel
wichtig, die Forderung
nach einer sauberen Schlitzfurche vor dem Zusammenschlag
für
die Reinhaltung des Ackers vor
Unkraut.
Die behutsame Steigerung der Arbeitstiefe bis zum 3.Umlauf des Zusammenschlags oder umgekehrt bei der Schlussfurche sollte einen unebenen Acker verhindern.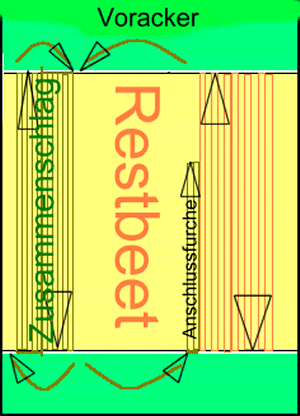
Die vom deutschen Pflügerrat oder der Pflügergemeinschaft Schleswig Holstein organisierten Wettbewerbe haben meist einen imposanten Charakter. Der Wettkampf-Acker ist mit Fahnen geschmückt. Wenn auch noch die Sonne lacht, sammeln sich die Teilnehmer dort morgens ganz besonders gern zum Empfang ihrer durch Los ermittelten Beetnummern. Auch die Beete wurden vorher vermessen und mit den dazu gehörenden Nummernfähnchen gezeichnet.
Damit jeder der vorher angemeldeten Teilnehmer einen Acker erhalten und in überschaubarer Zeit fertig stellen kann, sind diese nicht sehr groß: max ca. 20 mtr breit und 100 mtr lang. Während die Regeln noch einmal vorgelesen werden, legt sich die Aufregung.
Inzwischen hat ein jeder
seine Mitbewerber beäugt und den Acker einzuschätzen
versucht.
Aufregung.
Inzwischen hat ein jeder
seine Mitbewerber beäugt und den Acker einzuschätzen
versucht.
Alle vorher ausprobierten Einstellungen am Pflug können am Acker scheitern. Starker Bewuchs oder Ernterückstände wie Stroh können einen Pflüger arg quälen. Der Unterschied von schwerem zu leichtem Boden verändert die Einzugbereitschaft des Pfluges. Spuren im Acker bedeuten Verhärtungen mit schlechtem Einzug und sollen z udem noch
unterpflügt werden. Auch das macht Kummer. Aber letztlich
kämpfen alle mit den gleichen Problemen
und werden nur unterschiedlich gut damit fertig.
Zu den guten
aber
möchte jeder gehören. und jeder begibt sich dann an
den Acker
mit seiner zugeteilten Nummer. Vor der mit 2 Fluchtstangen
gezeichneten Linie seiner Anpflugfurche wird
Seiten/Technik/Leis
udem noch
unterpflügt werden. Auch das macht Kummer. Aber letztlich
kämpfen alle mit den gleichen Problemen
und werden nur unterschiedlich gut damit fertig.
Zu den guten
aber
möchte jeder gehören. und jeder begibt sich dann an
den Acker
mit seiner zugeteilten Nummer. Vor der mit 2 Fluchtstangen
gezeichneten Linie seiner Anpflugfurche wird
Seiten/Technik/Leis tungspf/Pf4.jpgAufstellung für die
Schlitzfurche genommen und der Pflug hierfür eingestellt.
tungspf/Pf4.jpgAufstellung für die
Schlitzfurche genommen und der Pflug hierfür eingestellt.
Der Voracker ist durch eine flache, möglichst nach innen gewendete Furche gekennzeichnet. Ein= und Aussetzen des Pfluges sollen vom Vorgewende aus möglichst in einer Linie nebeneinander, kurz vor der Begrenzungsfurche erfolgen. Aufgabe wird jetzt sein, im ersten Umlauf eine schnurgerade zweifurchige, möglichst flache Schlitzfurche mit gleichem Aushub nach beiden Seiten herzustellen und dabei allen Bewuchs sicher abzus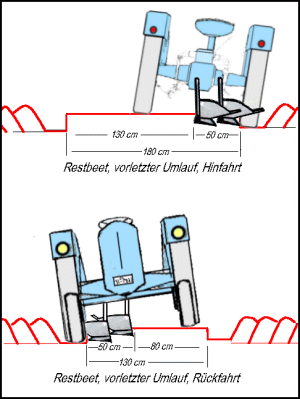 chneiden. Die Regel lautet :
„Es wird eine zweifurchige Spaltfurche gefordert –
alles
Land muss gewendet sein“. Der Start erfolgt nach
einem
Signal. Jetzt schleichen die Wettkämpfer los; denn jeder
möchte erst mal beobachten, wie die Pflugeinstellungen zum
Acker
passen. Nach
kleinen Korrekturen geht`s dann schon flotter. Damit die Spaltfurche
schnurgerade wird, sollte die Fluchtlinie immer über
mindestens 2
Fluchtstangen angepeilt
werden, von denen die erste nach Erreichen
hinter die zwei
chneiden. Die Regel lautet :
„Es wird eine zweifurchige Spaltfurche gefordert –
alles
Land muss gewendet sein“. Der Start erfolgt nach
einem
Signal. Jetzt schleichen die Wettkämpfer los; denn jeder
möchte erst mal beobachten, wie die Pflugeinstellungen zum
Acker
passen. Nach
kleinen Korrekturen geht`s dann schon flotter. Damit die Spaltfurche
schnurgerade wird, sollte die Fluchtlinie immer über
mindestens 2
Fluchtstangen angepeilt
werden, von denen die erste nach Erreichen
hinter die zwei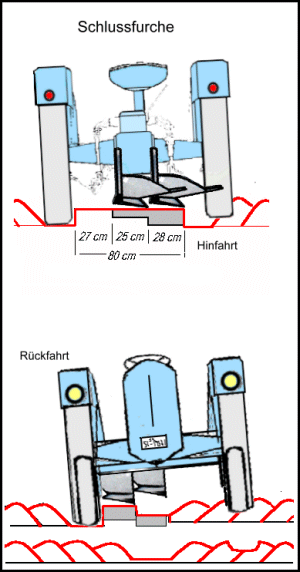 te gesetzt wird.
te gesetzt wird.
Der Schlepper steht vor der Hinfahrt zur Spaltfurche mittig über der Fluchtlinie, wobei der abgesenkte zweischarige Pflug, den wir hier als Beispiel nehmen, mit der Anlage die Fluchtlinie berührt. Der erste Körper läuft bei nach links verkantetem Pflug leer. Oberlenker lang. Arbeitstiefe ca. 4 cm, aber allen Bewuchs durchschneidend. Scheibensech nicht nach außen stellen. Die Anlage würde sonst keinen Halt finden.
Zu Beginn der Rückfahrt steht der Schlepper mittig über dem linken Furchenrand. Der Pflug wird zur Waagerechten zurückverkantet. Oberlenker etwas kürzen. Der 1. Körper arbeitet so flach wie der 2. auf der Hinfahrt. Der 2. Körper läuft leer, schneidet nur die kleine Schrägung der 1.Furche, damit die Anlage Halt findet. Erst nach Beurteilung der Spaltfurche durch die Preisrichter wird nach einem weiteren Signal mit dem Zusammenschlag begonnen. Dabei fährt der Schlepper auf der Hinfahrt mit seinen rechten Rädern in der Spaltfurche an der linken Kante entlang und pflügt mit beiden Körpern. Hierbei geht der erste nur flach unter den Aushub der Spaltfurche und produziert dabei einen nur flachen Furchendamm in die Spaltfurche, der von dem tiefer gehenden 2. Körper zum Teil zugedeckt wird.
Bei der Rückfahrt zum Zusammenschlag arbeiten beide Körper fast gleich tief, wobei der Furchendamm des 1.Körpers Anschluss an den 2. Furchendamm der Hinfahrt finden soll. Am Ende des 1.Umlaufs sind 3 Furchendämme in gleicher Höhe zu erkennen. Es ist auch zulässig, den 1.Umlauf mit 4 Furchenkämmen zu beenden, nur schwieriger zu bewerkstelligen. Die Arbeitstiefe wird allmählich gesteigert und erreicht beim 3.Umlauf das volle nach den Regeln festgelegte Maß.
Nach dem 3. Umlauf wird der Restacker in Angriff genommen. Die 1.Hinfahrt erfolgt dabei in der Furche des rechten Beetnachbarn. Die Fahrt für diese so genannte Anschlussfurche wird nicht gewertet, weil mit ihr eventuelle Korrekturen vorgenommen werden müssen, falls das Restbeet nicht parallel ist. Vor Beginn der Anschlussfurche sollte also mit einem Bandmaß die Breite des Restackers sowohl vorne als auch hinten ermittelt werden. Danach ist die endgültige Arbeitstiefe erreicht. Jetzt
sollte die tatsächliche Arbeitsbreite ermittelt und mit der
Breite
des Restbeetes abgestimmt werden. Das bedeutet auf der
1.Rückfahrt
zum Restbeet mehrmals vor dem Schlepper ein Maß von 2 mtr.
von
der Furchenkante ins Land abstecken und nach dem Durchpflügen
zurückmessen. Die Differenz ist die Arbeitsbreite.
Jetzt
sollte die tatsächliche Arbeitsbreite ermittelt und mit der
Breite
des Restbeetes abgestimmt werden. Das bedeutet auf der
1.Rückfahrt
zum Restbeet mehrmals vor dem Schlepper ein Maß von 2 mtr.
von
der Furchenkante ins Land abstecken und nach dem Durchpflügen
zurückmessen. Die Differenz ist die Arbeitsbreite.
Bei dieser Gelegenheit sollte auch noch einmal das Maß vom Restbeet hinter dem Pflug genommen werden. Es sollte durch die doppelte Arbeitsbreite teilbar sein oder entsprechend die Arbeitsbreite verändert werden. Ab drittletzter Umfahrt wird die Arbeitstiefe allmählich
reduziert. Die letzte Rückfahrt erfolgt in Richtung des
Start-Vorackers, wobei die Schlussfurche in Richtung des eigenen
Zusammenschlags hin gewendet wird. Sie soll einen
gleichmäßig gepflügten Acker
zurücklassen, ohne
Anzeichen schlecht untergebrachten Bewuchses oder von
Ernterückständen, mit gutem Furchenschluss, mit einer
flachen
nur 1=furchigen Restfurche und nur einer
sichtbaren Treckerspur.. Eine
Leerfahrt ist erlaubt.
allmählich
reduziert. Die letzte Rückfahrt erfolgt in Richtung des
Start-Vorackers, wobei die Schlussfurche in Richtung des eigenen
Zusammenschlags hin gewendet wird. Sie soll einen
gleichmäßig gepflügten Acker
zurücklassen, ohne
Anzeichen schlecht untergebrachten Bewuchses oder von
Ernterückständen, mit gutem Furchenschluss, mit einer
flachen
nur 1=furchigen Restfurche und nur einer
sichtbaren Treckerspur.. Eine
Leerfahrt ist erlaubt.
Spannend wird es wieder beim letzten Umlauf. Der setzt bei einem 2=scharigen Pflug ein paralleles Restbeet in der Breite von 3 Furchen voraus. Bei der Hinfahrt pflügt der 2. Körper halb so tief wie der erste. Der Schlepper läuft mit dem linken Radpaar in der linken Furche, mit dem rechten auf dem gepflügten Acker. Auf
der Rückfahrt läuft er rechts in der Furche
und links in
der auf der Hinfahrt produzierten Spur. Diese ist so nur einmal zu
sehen. Auf der Rückfahrt hat wieder der 1. Körper
mehr Druck
als der zweite, weshalb besondere Sorgfalt auf die Abstützung
zu
legen ist. Sonst bricht der Pflug aus und versaut die Schlussfurche. .
Für Prüfer und Zuschauer wird es wieder spannend;
denn
für sie wird erst zum Schluss sichtbar, ob die geplante und
ständig mit dem Bandmaß kontrollierte Aufteilung des
Restbeetes zu dem für den letzten Umlauf gewünschten
Maß geführt hat. Was bis jetzt an Punkten zusammen
kam, kann
im letzten und schwierigsten Umlauf wieder verloren gehen. Nach Ablauf
einer zu Beginn festgesetzten Frist muss die Schlussfurche fertig sein.
Auf
der Rückfahrt läuft er rechts in der Furche
und links in
der auf der Hinfahrt produzierten Spur. Diese ist so nur einmal zu
sehen. Auf der Rückfahrt hat wieder der 1. Körper
mehr Druck
als der zweite, weshalb besondere Sorgfalt auf die Abstützung
zu
legen ist. Sonst bricht der Pflug aus und versaut die Schlussfurche. .
Für Prüfer und Zuschauer wird es wieder spannend;
denn
für sie wird erst zum Schluss sichtbar, ob die geplante und
ständig mit dem Bandmaß kontrollierte Aufteilung des
Restbeetes zu dem für den letzten Umlauf gewünschten
Maß geführt hat. Was bis jetzt an Punkten zusammen
kam, kann
im letzten und schwierigsten Umlauf wieder verloren gehen. Nach Ablauf
einer zu Beginn festgesetzten Frist muss die Schlussfurche fertig sein.

Dann kommt die große Entspannung, der kleine Imbiss unter Freunden und das Warten auf die Ergebnisse. Inzwischen stecken die Preisrichter ihre Köpfe zusammen, um ihre Wertungen zu vergleichen. Aber insgeheim hat sich bereits jeder Pflüger nach einem Blick auf die Beete seiner Mitbewerber seine Platzierung schon zugeteilt. Der Rest st Publissity und vielleicht auch ein Pokal als sichtbarer Preis für die Lieben daheim. Das war ein Einblick in Spielregeln und Erfahrungen einer nicht ganz einfachen Sportart. Landwirten, die ihren Acker für einen solchen Wettkampf zur Verfügung stellen, gebührt ein ganz besonderer Dank. Schon die notwendige Terminabsprache für den Wettbewerb bedeutet für sie eine Zwangsjacke im von der Natur vorgegebenen Arbeitsablauf des Betriebes, ganz zu schweigen von den vielen zurückgelassenen Schlussfurchen. Und darum fehlt den meisten Teilnehmern sicher auch eine Möglichkeit zum Üben. Deshalb soll dieser Aufsatz neben einem Pflüger-Seminar des LBCH bei der Vorbereitung helfen. Viel Spaß und gut Pflug! Oskar
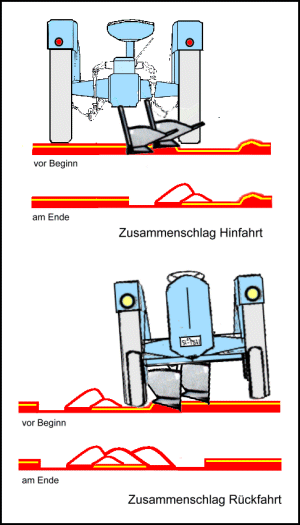 n,
und zwar mit Erfolg. Für sie war in der Schlepper Post
in ihrer März-Ausgabe 2004 der Aufsatz mit dem Titel:
„Im Märzen der Bauer...“ als
Vorbereitung für das
heutige Thema gedacht.
n,
und zwar mit Erfolg. Für sie war in der Schlepper Post
in ihrer März-Ausgabe 2004 der Aufsatz mit dem Titel:
„Im Märzen der Bauer...“ als
Vorbereitung für das
heutige Thema gedacht. Wer heute ohne Vorkenntnisse der früheren landwirtschaftlichen Arbeitsmethoden den Regeln des Leistungspflügens gegenübersteht, wird sich beim Vergleich zum heutigen Pflügen sicher wundern. Denn in alten Zeiten wurde meistens mit einfachen Beetpflügen gearbeitet, welche die Furchen nur nach rechts wenden. Man pflügte also um eine Mittelfurche so lange herum, bis das gepflügte Beet eine angemessene Breite erreicht hatte, und begann dann ein neues.
Dieses und das vorige, die man Zusammenschlag nennt, wurden so angelegt, dass bei Fertigstellung ein Restbeet zwischen den Zusammenschlägen in der Breite eines von ihnen übrig blieb. Mit wachsender Beetbreite wächst auch der Weg des Gespanns auf dem Vorgewende. Bis ca. 40 mtr. ist dieser gerade noch erträglich und bestimmte damit ebenfalls die Beetbreite. Im folgenden Jahr wurde die Anpflugfur
 che
über der Schlussfurche des
Vorjahres ausgeführt.
che
über der Schlussfurche des
Vorjahres ausgeführt.
Da Anpflugfurchen leicht einen Buckel, die Schlussfurchen leicht einen flachen Graben hinterlassen, blieben sie bis zur Einführung der Volldreh-Pflüge Sichtmarken für die Beet-Einteilung des Ackers.
Die Regeln des Leistungspflügens resultieren aus der Beet-Pflügerei vergangener Zeiten. Dabei unterliegt schon der Zusammenschlag schwierigen Kriterien, die in der zurückliegenden Praxis ihre Berechtigung hatten. Die strenge Forderung nach Geradlinigkeit der ersten Furche z.B. war für den Wechsel von Anpflug= und Schlussfurche im
 Jahreswechsel
wichtig, die Forderung
nach einer sauberen Schlitzfurche vor dem Zusammenschlag
für
die Reinhaltung des Ackers vor
Unkraut.
Jahreswechsel
wichtig, die Forderung
nach einer sauberen Schlitzfurche vor dem Zusammenschlag
für
die Reinhaltung des Ackers vor
Unkraut. Die behutsame Steigerung der Arbeitstiefe bis zum 3.Umlauf des Zusammenschlags oder umgekehrt bei der Schlussfurche sollte einen unebenen Acker verhindern.
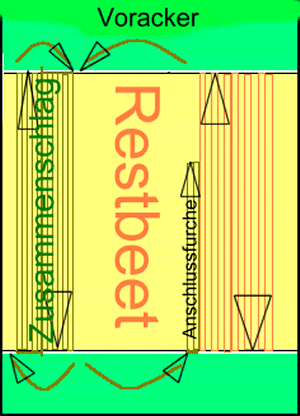
Die vom deutschen Pflügerrat oder der Pflügergemeinschaft Schleswig Holstein organisierten Wettbewerbe haben meist einen imposanten Charakter. Der Wettkampf-Acker ist mit Fahnen geschmückt. Wenn auch noch die Sonne lacht, sammeln sich die Teilnehmer dort morgens ganz besonders gern zum Empfang ihrer durch Los ermittelten Beetnummern. Auch die Beete wurden vorher vermessen und mit den dazu gehörenden Nummernfähnchen gezeichnet.
Damit jeder der vorher angemeldeten Teilnehmer einen Acker erhalten und in überschaubarer Zeit fertig stellen kann, sind diese nicht sehr groß: max ca. 20 mtr breit und 100 mtr lang. Während die Regeln noch einmal vorgelesen werden, legt sich die
 Aufregung.
Inzwischen hat ein jeder
seine Mitbewerber beäugt und den Acker einzuschätzen
versucht.
Aufregung.
Inzwischen hat ein jeder
seine Mitbewerber beäugt und den Acker einzuschätzen
versucht. Alle vorher ausprobierten Einstellungen am Pflug können am Acker scheitern. Starker Bewuchs oder Ernterückstände wie Stroh können einen Pflüger arg quälen. Der Unterschied von schwerem zu leichtem Boden verändert die Einzugbereitschaft des Pfluges. Spuren im Acker bedeuten Verhärtungen mit schlechtem Einzug und sollen z
 udem noch
unterpflügt werden. Auch das macht Kummer. Aber letztlich
kämpfen alle mit den gleichen Problemen
und werden nur unterschiedlich gut damit fertig.
Zu den guten
aber
möchte jeder gehören. und jeder begibt sich dann an
den Acker
mit seiner zugeteilten Nummer. Vor der mit 2 Fluchtstangen
gezeichneten Linie seiner Anpflugfurche wird
Seiten/Technik/Leis
udem noch
unterpflügt werden. Auch das macht Kummer. Aber letztlich
kämpfen alle mit den gleichen Problemen
und werden nur unterschiedlich gut damit fertig.
Zu den guten
aber
möchte jeder gehören. und jeder begibt sich dann an
den Acker
mit seiner zugeteilten Nummer. Vor der mit 2 Fluchtstangen
gezeichneten Linie seiner Anpflugfurche wird
Seiten/Technik/Leis tungspf/Pf4.jpgAufstellung für die
Schlitzfurche genommen und der Pflug hierfür eingestellt.
tungspf/Pf4.jpgAufstellung für die
Schlitzfurche genommen und der Pflug hierfür eingestellt. Der Voracker ist durch eine flache, möglichst nach innen gewendete Furche gekennzeichnet. Ein= und Aussetzen des Pfluges sollen vom Vorgewende aus möglichst in einer Linie nebeneinander, kurz vor der Begrenzungsfurche erfolgen. Aufgabe wird jetzt sein, im ersten Umlauf eine schnurgerade zweifurchige, möglichst flache Schlitzfurche mit gleichem Aushub nach beiden Seiten herzustellen und dabei allen Bewuchs sicher abzus
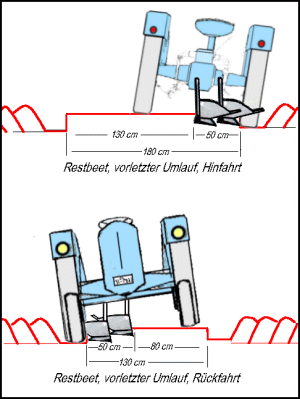 chneiden. Die Regel lautet :
„Es wird eine zweifurchige Spaltfurche gefordert –
alles
Land muss gewendet sein“. Der Start erfolgt nach
einem
Signal. Jetzt schleichen die Wettkämpfer los; denn jeder
möchte erst mal beobachten, wie die Pflugeinstellungen zum
Acker
passen. Nach
kleinen Korrekturen geht`s dann schon flotter. Damit die Spaltfurche
schnurgerade wird, sollte die Fluchtlinie immer über
mindestens 2
Fluchtstangen angepeilt
werden, von denen die erste nach Erreichen
hinter die zwei
chneiden. Die Regel lautet :
„Es wird eine zweifurchige Spaltfurche gefordert –
alles
Land muss gewendet sein“. Der Start erfolgt nach
einem
Signal. Jetzt schleichen die Wettkämpfer los; denn jeder
möchte erst mal beobachten, wie die Pflugeinstellungen zum
Acker
passen. Nach
kleinen Korrekturen geht`s dann schon flotter. Damit die Spaltfurche
schnurgerade wird, sollte die Fluchtlinie immer über
mindestens 2
Fluchtstangen angepeilt
werden, von denen die erste nach Erreichen
hinter die zwei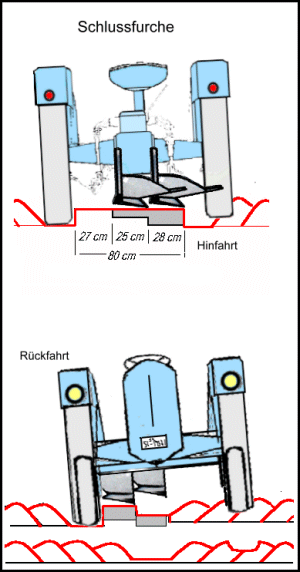 te gesetzt wird.
te gesetzt wird. Der Schlepper steht vor der Hinfahrt zur Spaltfurche mittig über der Fluchtlinie, wobei der abgesenkte zweischarige Pflug, den wir hier als Beispiel nehmen, mit der Anlage die Fluchtlinie berührt. Der erste Körper läuft bei nach links verkantetem Pflug leer. Oberlenker lang. Arbeitstiefe ca. 4 cm, aber allen Bewuchs durchschneidend. Scheibensech nicht nach außen stellen. Die Anlage würde sonst keinen Halt finden.
Zu Beginn der Rückfahrt steht der Schlepper mittig über dem linken Furchenrand. Der Pflug wird zur Waagerechten zurückverkantet. Oberlenker etwas kürzen. Der 1. Körper arbeitet so flach wie der 2. auf der Hinfahrt. Der 2. Körper läuft leer, schneidet nur die kleine Schrägung der 1.Furche, damit die Anlage Halt findet. Erst nach Beurteilung der Spaltfurche durch die Preisrichter wird nach einem weiteren Signal mit dem Zusammenschlag begonnen. Dabei fährt der Schlepper auf der Hinfahrt mit seinen rechten Rädern in der Spaltfurche an der linken Kante entlang und pflügt mit beiden Körpern. Hierbei geht der erste nur flach unter den Aushub der Spaltfurche und produziert dabei einen nur flachen Furchendamm in die Spaltfurche, der von dem tiefer gehenden 2. Körper zum Teil zugedeckt wird.
Bei der Rückfahrt zum Zusammenschlag arbeiten beide Körper fast gleich tief, wobei der Furchendamm des 1.Körpers Anschluss an den 2. Furchendamm der Hinfahrt finden soll. Am Ende des 1.Umlaufs sind 3 Furchendämme in gleicher Höhe zu erkennen. Es ist auch zulässig, den 1.Umlauf mit 4 Furchenkämmen zu beenden, nur schwieriger zu bewerkstelligen. Die Arbeitstiefe wird allmählich gesteigert und erreicht beim 3.Umlauf das volle nach den Regeln festgelegte Maß.
Nach dem 3. Umlauf wird der Restacker in Angriff genommen. Die 1.Hinfahrt erfolgt dabei in der Furche des rechten Beetnachbarn. Die Fahrt für diese so genannte Anschlussfurche wird nicht gewertet, weil mit ihr eventuelle Korrekturen vorgenommen werden müssen, falls das Restbeet nicht parallel ist. Vor Beginn der Anschlussfurche sollte also mit einem Bandmaß die Breite des Restackers sowohl vorne als auch hinten ermittelt werden. Danach ist die endgültige Arbeitstiefe erreicht.
 Jetzt
sollte die tatsächliche Arbeitsbreite ermittelt und mit der
Breite
des Restbeetes abgestimmt werden. Das bedeutet auf der
1.Rückfahrt
zum Restbeet mehrmals vor dem Schlepper ein Maß von 2 mtr.
von
der Furchenkante ins Land abstecken und nach dem Durchpflügen
zurückmessen. Die Differenz ist die Arbeitsbreite.
Jetzt
sollte die tatsächliche Arbeitsbreite ermittelt und mit der
Breite
des Restbeetes abgestimmt werden. Das bedeutet auf der
1.Rückfahrt
zum Restbeet mehrmals vor dem Schlepper ein Maß von 2 mtr.
von
der Furchenkante ins Land abstecken und nach dem Durchpflügen
zurückmessen. Die Differenz ist die Arbeitsbreite. Bei dieser Gelegenheit sollte auch noch einmal das Maß vom Restbeet hinter dem Pflug genommen werden. Es sollte durch die doppelte Arbeitsbreite teilbar sein oder entsprechend die Arbeitsbreite verändert werden. Ab drittletzter Umfahrt wird die Arbeitstiefe
 allmählich
reduziert. Die letzte Rückfahrt erfolgt in Richtung des
Start-Vorackers, wobei die Schlussfurche in Richtung des eigenen
Zusammenschlags hin gewendet wird. Sie soll einen
gleichmäßig gepflügten Acker
zurücklassen, ohne
Anzeichen schlecht untergebrachten Bewuchses oder von
Ernterückständen, mit gutem Furchenschluss, mit einer
flachen
nur 1=furchigen Restfurche und nur einer
sichtbaren Treckerspur.. Eine
Leerfahrt ist erlaubt.
allmählich
reduziert. Die letzte Rückfahrt erfolgt in Richtung des
Start-Vorackers, wobei die Schlussfurche in Richtung des eigenen
Zusammenschlags hin gewendet wird. Sie soll einen
gleichmäßig gepflügten Acker
zurücklassen, ohne
Anzeichen schlecht untergebrachten Bewuchses oder von
Ernterückständen, mit gutem Furchenschluss, mit einer
flachen
nur 1=furchigen Restfurche und nur einer
sichtbaren Treckerspur.. Eine
Leerfahrt ist erlaubt. Spannend wird es wieder beim letzten Umlauf. Der setzt bei einem 2=scharigen Pflug ein paralleles Restbeet in der Breite von 3 Furchen voraus. Bei der Hinfahrt pflügt der 2. Körper halb so tief wie der erste. Der Schlepper läuft mit dem linken Radpaar in der linken Furche, mit dem rechten auf dem gepflügten Acker.
 Auf
der Rückfahrt läuft er rechts in der Furche
und links in
der auf der Hinfahrt produzierten Spur. Diese ist so nur einmal zu
sehen. Auf der Rückfahrt hat wieder der 1. Körper
mehr Druck
als der zweite, weshalb besondere Sorgfalt auf die Abstützung
zu
legen ist. Sonst bricht der Pflug aus und versaut die Schlussfurche. .
Für Prüfer und Zuschauer wird es wieder spannend;
denn
für sie wird erst zum Schluss sichtbar, ob die geplante und
ständig mit dem Bandmaß kontrollierte Aufteilung des
Restbeetes zu dem für den letzten Umlauf gewünschten
Maß geführt hat. Was bis jetzt an Punkten zusammen
kam, kann
im letzten und schwierigsten Umlauf wieder verloren gehen. Nach Ablauf
einer zu Beginn festgesetzten Frist muss die Schlussfurche fertig sein.
Auf
der Rückfahrt läuft er rechts in der Furche
und links in
der auf der Hinfahrt produzierten Spur. Diese ist so nur einmal zu
sehen. Auf der Rückfahrt hat wieder der 1. Körper
mehr Druck
als der zweite, weshalb besondere Sorgfalt auf die Abstützung
zu
legen ist. Sonst bricht der Pflug aus und versaut die Schlussfurche. .
Für Prüfer und Zuschauer wird es wieder spannend;
denn
für sie wird erst zum Schluss sichtbar, ob die geplante und
ständig mit dem Bandmaß kontrollierte Aufteilung des
Restbeetes zu dem für den letzten Umlauf gewünschten
Maß geführt hat. Was bis jetzt an Punkten zusammen
kam, kann
im letzten und schwierigsten Umlauf wieder verloren gehen. Nach Ablauf
einer zu Beginn festgesetzten Frist muss die Schlussfurche fertig sein.

Dann kommt die große Entspannung, der kleine Imbiss unter Freunden und das Warten auf die Ergebnisse. Inzwischen stecken die Preisrichter ihre Köpfe zusammen, um ihre Wertungen zu vergleichen. Aber insgeheim hat sich bereits jeder Pflüger nach einem Blick auf die Beete seiner Mitbewerber seine Platzierung schon zugeteilt. Der Rest st Publissity und vielleicht auch ein Pokal als sichtbarer Preis für die Lieben daheim. Das war ein Einblick in Spielregeln und Erfahrungen einer nicht ganz einfachen Sportart. Landwirten, die ihren Acker für einen solchen Wettkampf zur Verfügung stellen, gebührt ein ganz besonderer Dank. Schon die notwendige Terminabsprache für den Wettbewerb bedeutet für sie eine Zwangsjacke im von der Natur vorgegebenen Arbeitsablauf des Betriebes, ganz zu schweigen von den vielen zurückgelassenen Schlussfurchen. Und darum fehlt den meisten Teilnehmern sicher auch eine Möglichkeit zum Üben. Deshalb soll dieser Aufsatz neben einem Pflüger-Seminar des LBCH bei der Vorbereitung helfen. Viel Spaß und gut Pflug! Oskar
siehe auch: Pflügergemeinschaft
Schleswig-Holstein
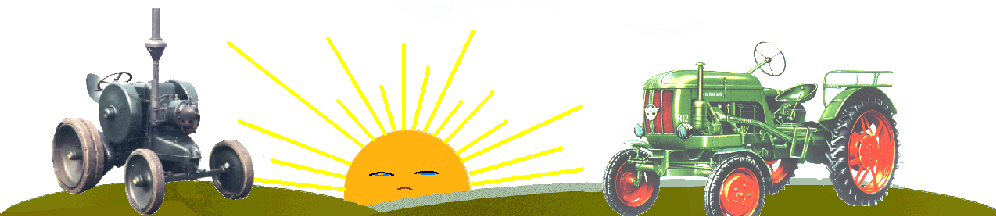
copy: Oskar Sellschopp